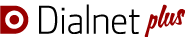Geldstrafe und Ersatzfreiheitsstrafe in Schweden – Ein Vergleich mit dem deutschen System
- Autores: Nicole Bögelein, Frank Wilde, Axel Holmgren
- Localización: Monatsschrift für kriminologie und strafrecht, ISSN 0026-9301, Vol. 105, Nº. 2, 2022, págs. 102-112
- Idioma: alemán
- Texto completo no disponible (Saber más ...)
-
Resumen
- English
In the discussion on imprisonment for non-payment in Germany, Sweden is often used for comparison, although the exact Swedish procedure of fine enforcement is unknown. This text presents the procedure for imposing and enforcing fines and imprisonment for non-payment in Sweden and draws a comparison with Germany. In Sweden, as in Germany, many fines are imposed by means of penal orders. Nevertheless, there is one important difference; the sentenced person must agree to the penal order. Significant differences can be seen in the daily units, which in Sweden are much lower by law (5 €–100 €). Moreover, their calculation is based on the forfeiture principle, not on the net income principle as in Germany. The enforcement of fines in Sweden is not carried out by the public prosecutor’s office, but by the Enforcement Authority (Kronofogden). Furthermore, default imprisonment is only enforced if the sentenced person shows an unwillingness to pay – in 2019 there were 13 default imprisonment cases. This is mainly due to the Swedish attitude that the purpose of the fine is not to convert all unpaid fines into custodial sentences, but to let them pass if a person is unable to pay. Kronofogden checks every other year whether the convicted person is able to pay; if this is not the case, after a time-limit of 5 years the fine is dropped. Of all fines that were imposed in 2015, 41.4 % were terminated by the statute of limitations. This shows the high proportion of convicted persons who are unable to pay.
- Deutsch
In der Diskussion über die Ersatzfreiheitsstrafe in Deutschland wird Schweden häufig zum Vergleich herangezogen, allerdings ist das genaue Vorgehen weitgehend unbekannt. Der vorliegende Text stellt die Vorgehensweise bei der Verhängung und Vollstreckung von Geld- und Ersatzfreiheitsstrafen in Schweden dar und zieht den Vergleich zu Deutschland. Genau wie in Deutschland werden auch in Schweden viele Geldstrafen über Strafbefehle verhängt, dort muss der/die Verurteilte dem Strafbefehl allerdings zustimmen. Wesentliche Unterschiede zeigen sich bei den Tagessatzhöhen, die in Schweden von Gesetzes wegen deutlich niedriger sind (5 €–100 €). Die Berechnung erfolgt dort zudem nach dem Einbußeprinzip, nicht wie in Deutschland nach den Nettoeinkommensprinzip. Die Vollstreckung verhängter Geldstrafen übernimmt in Schweden nicht die Staatsanwaltschaft, sondern das Amt für Beitreibung (Kronofogden). Weiterhin werden nur dann Ersatzfreiheitsstrafen vollstreckt, wenn Zahlungsunwilligkeit vorliegt – im Jahr 2019 in 13 Fällen. Das liegt wohl v. a. an der schwedischen Haltung, die den Zweck der Geldstrafe nicht darin sieht, alle unbezahlten Geldstrafen in eine Freiheitsstrafe umzuwandeln, sondern sie im Falle von Zahlungsunfähigkeit fallen zu lassen. Kronofogden prüft zweijährlich, ob der/die Verurteilte inzwischen bezahlen kann. Ist dies nicht der Fall, so verjähren die Strafen nach 5 Jahren. Von den 2015 verhängten Geldstrafen wurden 41,4 % durch Verjährung beendet. Das zeigt den hohen Anteil zahlungsunfähiger Verurteilter.
- English
© 2001-2024 Fundación Dialnet · Todos los derechos reservados